Myanmar: Protest gegen den Militärputsch und zwei kleine Episoden aus der langen Geschichte der Unterdrückung in diesem Land

„In Myanmar haben die Sicherheitskräfte bei neuen Protesten gegen die Militärjunta mindestens fünf Menschen getötet“ — „Hunderttausende auf den Straßen von Myanmar“ — „Die Protestbewegung antwortet auf die Warnungen des Militärs mit Generalstreik“ … Meldungen wie diese hören wir zurzeit fast täglich in den Medien.
Wir sehen auf den Transparenten die enorm große Unterstützung für die im November 2020 mit absoluter Mehrheit wiedergewählte Präsidentin Aung San Suu Kyi. Sie steht für den Prozess der Demokratisierung, der 2010 begann und 2015 zur absoluten Mehrheit ihrer Partei führte. Weiterhin gab es erhebliche Einschränkungen der Meinungs– und Pressefreiheit, regierungskritische Journalisten wurden verhaftet, doch eine Bewegung hin zur Demokratisierung war in Gang gesetzt.

Wir wissen, dass die charismatische und überaus hoffnungsvolle Friedensnobelpreisträgerin von 1991 in den letzten Jahren zum Völkermord an den Rohingya (2015/17) in ihrem Land schwieg. Das Nobelkomitee beriet sogar darüber, ihr den Nobelpreis wieder abzuerkennen. Amnesty International vollzog diesen Schritt und sprach ihr im November 2018 den Ehrentitel „Botschafter des Gewissens“ wieder ab. Dennoch ist Aung San Suu Kyi in der Bevölkerung wie eine Personifizierung ihrer Hoffnung auf einen Demokratisierungsprozess in Myanmar mit freien Wahlen, Meinungs– und Pressefreiheit. Die Wut richtet sich gegen den Militärputsch, die Verhaftungen, die Nichtanerkennung des Wahlergebnisses und den Hausarrest, unter dem nun Aung San Suu Kyi erneut steht.
Schauspieler*innen, Musiker*innen, Küstler*innen, Schriftsteller*innen sind auf den Straßen und erheben in vielfältiger Weise ihre Stimme. Kritische Journalisten wie z.B. Mratt Kyaw Thu werden inhaftiert.
Myanmar ist etwa doppelt so groß wie Deutschland und hat ungefähr die Hälfte unserer Einwohnerzahl. Es ist ein Vielvölkerstaat mit 135 verschiedenen Ethnien; fast 90% sind Buddhisten, 4% Moslems (Rohingya) und 6% Christen. Myanmar hat eine lange Geschichte der Unterdrückung von Meinungs– und Redefreiheit. Für ethnische und religiöse Minderheiten bedeutete dies immer eine doppelte Bedrohung. So mussten Christen z.B. zeitweise in Lagern für Binnenflüchtlinge wohnen und hatten nur begrenzten Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung.
Was dies für den Einzelnen bedeutet, wie auch das gesprochene Wort überwacht wird, wie sich Bedrohung und Angst förmlich in die Menschen eingraben, erlebt Donata Elschenbroich bei ihrem Besuch in diesem Land:
Paing kui. Pfarrer in der Minderheit der Chin im Norden von Myanmar. Zu seinem Dorf in den Bergen führte keine Straße. Von der nächstgelegenen Stadt Kanpetlet erreichte man das Dorf in zwei Tageswanderungen.
Die Dorfbewohner trugen von jeher das Pflanzgut und die Werkzeuge auf dem Rücken über die Berge.
Irgendwann hatten sie im Dorf auf seine Initiative hin beschlossen, selbst eine Straße zu bauen. Im Jahr 2012 führte diese Straße endlich in die Kleinstadt. Ein Weg, befahrbar wenigstens für Motorräder.
Und nachdem das Land Myanmar in diesem Jahr nach einer zaghaften Demokratisierung, nach ersten Kompromissen mit dem Militär, nach jahrzehntelanger Repression durch die Zentralregierung, sich zu öffnen schien, waren wir angereist mit der Kamera um diesen Wegebau zu dokumentieren.
Erstmals konnte man als Angehöriger der Minderheit der Chin nun einen Personalausweis erhalten. Bis dahin hatten die marginalisierten ethnischen Gruppen in Myanmar ihre Regionen nicht verlassen dürfen.
Paing kui kam nach Yangon um uns abzuholen. Drei Tage brauchte er für die Anreise.
Ein Treffen im Hotel.
Was war los mit Paing kui?
So einsilbig kannte ich ihn nicht. War er erschöpft von der Reise?
Er blickte immer wieder zur Seite, sein Blick glitt über die Wände des Hotelfoyers.
Man wusste bis in die entferntesten Bergregionen von Myanmar:
In der jahrzehntelangen Hauptstadt steckt Unsichtbares in den Wänden.
Dort wird das gesprochene Wort mitgehört.
Ein weiteres Beispiel:
Thaung si, Angehöriger der Lisu, einer christlichen Minderheit. Ein Landwirtschaftslehrer in einem Theologischen Seminar außerhalb von Mandalay, im Norden von Myanmar.
2012 schien auch hier ein Neuanfang zu sein. Optimistische Aufbruchstimmung unter den etwa hundert Studentinnen und Studenten. Temperamentvolles Hin und Her beim Essen, bei der Feldarbeit. Und ihr Chorgesang! Klangvoll, begeistert vielstimmig (Händel, Messias).
Dann aber in den Klassenräumen: von einem Augenblick zum nächsten, wurden sie andere. Verhalten. Blickten unter sich. Unbehagliche Pausen vor zaghaften Antworten.
Thaung si erzählte: Bis vor wenigen Monaten hatte noch in jeder seiner Unterrichtstunden hinter ihm gestanden ein Wachsoldat der burmesischen Armee. Das Gewehr im Anschlag. Hätte der christliche Landwirtschaftslehrer Thaung si Kritisches über die burmesische Regierung gelehrt, der Soldat hätte auf ihn schießen müssen.
Dazu war es nie gekommen.
Die Wachsoldaten hatten ihren Dienst getan, ihre Präsenz gezeigt, mehr nicht. Junge Männer, oft freundlich.
Aber ihr Auftrag, ihre Anwesenheit, ihre Waffe, war allen selbstverständlich geworden. Für den Lehrer, für die künftigen Pfarrer und für die Soldaten selbst, die Bewacher des gesprochenen Worts.
2011 hatte ein Reformprozess in Myanmar begonnen. Jetzt, nach dem Militärputsch am 1. Februar 2021 wurde die Presse– und Meinungsfreiheit in Myanmar in wenigen Tagen wieder um zehn Jahre zurückgeworfen.













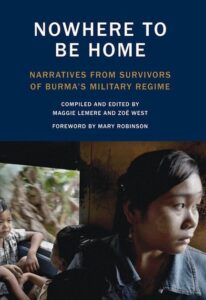
 Top
Top